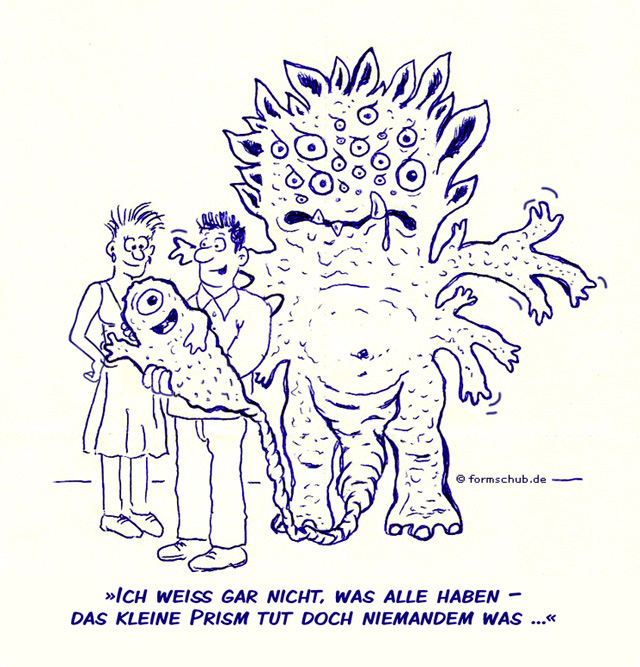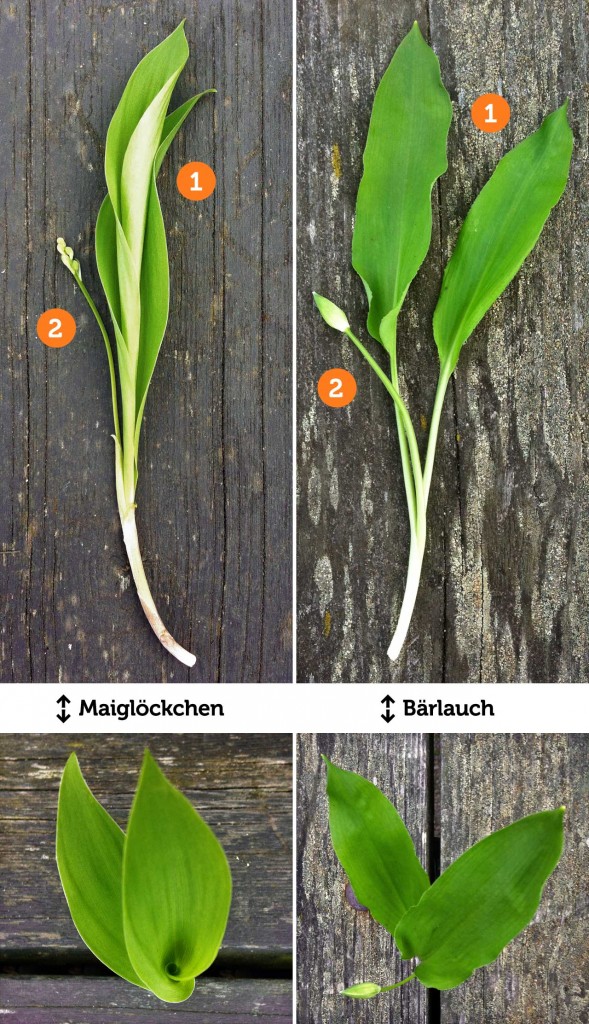Wenn es etwas gibt, was das Internet bei mir bewirkt hat, seit ich es (seit 1997) nutze, dann, dass es mich zu einem politisch sehr viel interessierteren Menschen gemacht hat. In prä-online-Zeiten gab es nur die Printmedien und das Fernsehen, um sich politisch zu informieren. Eine oder mehrere Zeitungen oder Magazine regelmäßig, womöglich täglich zu lesen, brauchte viel Zeit, kostete einiges an Geld und das Verfolgen tiefergehender Rundfunk- oder Fernsehnachrichten erforderte die Anpassung an den Programmplan der TV-Sender oder das mühsame Aufzeichnen und spätere Schauen. Zumindest mein Informationsgrad blieb daher lange relativ oberflächlich.
Inzwischen, da ich online Nachrichten und Seiten abonnieren kann, mich selektiv zu einzelnen Themen informieren (lassen) kann, wuchs auch mein politisches Bewusstsein. Ich versuche, Zusammenhänge zu begreifen, Themen tiefer zu recherchieren, kann mir leichter eine möglichst fundierte Meinung bilden und anschließend durch die Teilnahme an (konstruktiven) Diskussionen oder Demonstrationen, durch das Teilen und Weiterverbreiten von Links oder durch das Zeichnen von Petitionen Einfluss auf die politische Meinungsbildung und Entwicklung nehmen. Einfach, weil es mir durch das Internet leichter gemacht wird, dies zu tun. Das ist eine tolle Sache.
Das politische Thema, das natürlich auch mich in den letzten Wochen am meisten beschäftigt hat, ist die Abhörtätigkeit der NSA und anderer westlicher Geheimdienste, inklusive des britischen GCHQ und des deutschen BND. Ich verwende bewusst nicht die Begriffe PRISM und TEMPORA, da sich ja inzwischen herausgestellt hat, dass diese nur kleine Module darstellen in dem viel größeren Konstrukt, das dahinterliegt und der Öffentlichkeit bislang kaum bekannt ist.
Ich finde es gut, dass dieses Thema öffentlich geworden ist und auch in den On- und Offline-Medien sehr fundiert erörtert und kommentiert wird. Ich finde es gut, dass (hoffentlich immer mehr) Menschen darüber diskutieren und diesen Aktionen – möglichst über Ländergrenzen hinaus – maßvolle Grenzen setzen wollen. Ich bin der Meinung, bei der Massenerfassung dieser Daten handelt sich um einen Grundrechtsbruch und um die gezielte Umkehrung der Unschuldsvermutung. Und ich finde es beschämend, wie die meisten Politiker dieser und früherer Regierungsparteien darauf reagieren, bin extrem enttäuscht von der Politik insgesamt und den sogenannten »Volksvertretern«, die diesen Titel jeden Tag unangemessener erscheinen lassen, was mir natürlich auch die Entscheidung bei der kommenden Bundestagswahl (und: ja, ich werde wählen gehen!) nicht einfacher macht. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Was Edward Snowden tat, indem er diese Programme öffentlich machte, hat meinen Respekt. Er setzt sich damit als sehr junger Mensch einer Verfolgung und einem Risiko aus, die geeignet sind, sein gesamtes weiteres Leben zu beeinträchtigen oder es sogar zu verlieren. Ich hoffe, dass die Dinge, die er damit in Bewegung gesetzt hat, den Menschen, ihrer Freiheit und ihren Grundrechten zugute kommen werden.
Warum schreibe ich diesen Blogartikel? Sicher nicht, weil noch zu wenig über die Spähprogramme im Internet steht. Ich habe vielmehr das Gefühl, die öffentliche Diskussion sollte über das Statement »wir wollen nicht a) länger und b) in diesem Ausmaß überwacht werden« hinausgehen. Es geht auch um weit mehr als darum, ob wir »etwas zu verbergen haben« oder nicht.
1. Wir sind euphorisch und naiv
Einer unter den Artikeln, die mich in den letzten Tagen am nachdenklichsten gemacht haben, war ein Gastbeitrag des ehemaligen BND-Vizechefs Rudolf G. Adam in der Süddeutschen Zeitung. Dort heißt es:
Das Internet entstand aus dem Bedürfnis des US-Militärs, ein Kommunikationssystem zu entwickeln, das auch unter chaotischen Bedingungen sicher funktioniert. Die erste Naivität besteht nun darin zu glauben, das Militär habe sein Interesse am Internet verloren, seitdem es zur zivilen Nutzung freigegeben worden ist.
Da ist was dran. Die Euphorie über die Möglichkeiten und Chancen, die das Netz bietet, können durchaus dazu beigetragen haben, dass wir Netznutzer die Wurzeln des World Wide Web vergessen haben und es (ausschließlich) als eine Infrastruktur gesehen haben, die »dem Volk« zugute kommt. Doch dem ist nicht so. Das muss man akzeptieren – und es dämpft bei mir das »unbeschwerte« Gefühl, das ich bisher online hatte, maßgeblich. Doch gerade deshalb empfinde ich die Diskussion über Abhörmaßnahmen als um so wichtiger.
Der Artikel führt weiterhin aus, dass natürlich auch »nicht-westliche« Geheimdienste das Internet abhören und mit Sicherheit nicht damit aufhören werden, selbst wenn die Proteste der Menschen in Europa und Amerika zu Beschränkungen der Geheimdienstaktivitäten führen. Auch das muss man akzeptieren – ganz eindämmen kann und sollte man diese Maßnahmen in absehbarer Zeit klugerweise nicht. Idealistische Forderungen, alle Geheimdienste sollten einfach mit sämtlichen Überwachungsmaßnahmen aufhören, halte ich für weltfremd und wenig zielführend.
2. Wir sind arglos und vergesslich
Das Zweite, was ich durch die Enthüllungen Snowdens über die NSA gelernt habe: obwohl seine Enthüllungen wichtig und weitreichend sind, erzählt er uns im Grunde genommen, nicht nur Neues. In den letzten Tagen kam auch ein alter SPIEGEL-Artikel aus dem Jahre 1989 (!) wieder ans Tageslicht. Darin wird ausführlich berichtet, wie umfassend schon damals in der Vor-Internet-Ära die weltweite Telekommunikation durch die NSA überwacht und abgehört wurde – inklusive Schilderung der Empörung unter Politikern und Bürgern. Doch offenbar geriet diese erste Enthüllung inzwischen wieder komplett in Vergessenheit.
Warum folgte diesem Bericht damals kein Sturm der Entrüstung, keine Diskussionen, keine Demonstrationen? Vielleicht unter anderem auch, weil es das Internet noch nicht gab und sich sowohl der Bericht nicht dynamisch genug »herumsprechen« konnte als auch die heutigen Vernetzungsmöglichkeiten zur Verabredung und Organisation von z.B. Demonstrationen noch gar nicht gegeben waren. Und vielleicht auch, weil es »nur« um Telekommunikation ging. Zwar tauschte man auch 1989 schon viele und wichtige Nachrichten per Fax und Telefon aus, aber beide Technologien waren weitaus weniger umfassend und tiefgreifend mit nahezu allen Momenten des Alltags verwoben, wie es heute das Internet ist. »Ist ja nur Telefon«, dachte damals vielleicht mancher und ging nach draußen, um seine Überweisungen bei der Bank abzugeben und danach einen Urlaub im Reisebüro zu buchen.
3. Wir sind vertrauensselig und optimistisch
Ganze Scharen von Sprechern, Politikern und »Experten«, die derzeit die Wogen glätten und die Diskussion beschwichtigen oder herunterspielen wollen, versichern, es geschähe alles in gesunder Verhältnismäßigkeit, sei völlig legal, die Daten würden nicht missbraucht, alles sei sicher gespeichert, würde nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht, etc. Mal angenommen, man nähme selbst die damit verbundenen Grundrechtsbrüche in Kauf, und gleichfalls angenommen, man könnte darauf vertrauen, dass diese Beteuerungen für den Moment der Wahrheit entsprechen und »die da oben« die gesammelten Daten schon anständig und gewissenhaft verwalten und verwenden würden – wer garantiert uns denn, dass das so bleibt? Ich werfe nur einen mulmigen Blick zu unserem Nachbarn und EU-Mitglied (!) Ungarn, wo sich »demokratisch legitimiert« eine massive Unterdrückung oppositioneller Kräfte abspielt. Was passiert mit den längerfristig gespeicherten Daten, wenn in fünf, zehn, zwanzig Jahren in einem heute freiheitlichen Land politische Umwälzungen eine andere Regierung ans Ruder bringen, der die Rechte ihrer Bürger (noch) weniger wert sind? Davor habe ich Angst. Ich will jetzt schon etwas dagegen getan wissen, dass weder heute noch in Zukunft jemand meine (Meta-)Daten missbrauchen kann.
4. Wir sind technikgläubig und überheblich
Die Mengen an (Meta-)Daten, die aktuell gesammelt sind, sprengen schon jetzt jedes Vorstellungsvermögen. Selbst Begriffe wie Yottabyte oder eine Gegenüberstellung der gesammelten Stasi-Daten mit der NSA-Datenbank helfen nur bedingt, diese Dimensionen zu erfassen. Das kann kein noch so großes Heer von Menschen mehr persönlich auswerten. Im o.g. Artikel der SZ schätzt Rudolf G. Adam, dass einer der maximal darauf angesetzten 50.000 Auswerter der NSA pro Tag nicht mehr als 50 Kommunikationsabläufe sichten und operativ bewerten kann. Selbst die damit erzielten 2,5 Mio. Vorgänge pro Tag decken nur 0,1% der täglich erfassten 2 Milliarden Kommunikationsabläufe ab. Den Rest müssen Maschinen erledigen.
Wenn Maschinen weltweit menschliche Kommunikation entschlüsseln, sind hochleistungsfähige Computer und Algorithmen im Spiel. Doch auch sie werden von Menschen programmiert und können nur vorgegebenen Schemata folgen. Was ist mit (automatisierten) Übersetzungen und damit einhergehenden Übersetzungsfehlern? Ironie? Sarkasmus? Humor? Bewusste Wortspiele? Kommunikationsmuster außerhalb der programmierten Schemata, die täglich millionenfach durchs Internet strömen und damit Fehlerquellen, die geeignet sind, Menschen ungerechtfertigt in Verdacht zu bringen. Eine gigantische Kafka-Maschine. Wie riskant es ist, sich Algorithmen auszuliefern, erzählt der Programmierer Lukas F. Hartmann, der durch einen Programmierfehler bei einem privaten Genom-Analyseservice eine falsche Krankheitsdiagnose erhielt.
Daneben existieren in der Statistik generell und unabhängig von Softwarefehlern die Begriffe der sogenannten »falsch positiven« und »falsch negativen« Befunde, eine Art Fehlergrundrauschen, das bei allen massenhaften Auswertungs- und Analyseverfahren von vornherein einkalkuliert wird und in der analogen Welt quasi unvermeidlich ist. Es wird also zwangsläufig bei der automatisierten Auswertung von Datenmengen sowohl zu unbegründeten Verdächtigungen führen als auch zu unentdeckten »echten« Fällen. Wer schützt die Bürger gegenüber den so mächtigen Geheimdienstinstanzen vor solchen Kollateralschäden? Ein Blick nach Guantanamo bekräftigt die Berechtigung dieser Frage.
5. Wir vernachlässigen den Faktor Mensch
Ebenso riskant, wie es ist, Maschinen menschliche Kommunikation auswerten und private bis intime Daten verwalten zu lassen, ist es, dies von Menschen erledigen zu lassen – erst recht, wenn diese Auswertung von den Geheimdiensten auch noch an privatwirtschaftliche Unternehmen outgesourced wird.
Wenn Whistleblower ihre Position und ihren Zugriff auf geheime Daten ausnutzen, um die Öffentlichkeit zu informieren, wird dies von vielen respektiert und begrüßt. Doch diese aus Sicht ihres Arbeitgebers »abtrünnigen« Angestellten stellen nur das eine Ende der Skala dar. Was ist mit korrupten, machtgierigen, kriminell veranlagten, geldgeilen oder anderweitig illoyalen Mitarbeitern, die ebenso in Versuchung kommen könnten, die ihnen anvertrauten Daten, Erkenntnisse und Befugnisse anders zu nutzen, als es »erlaubt« oder vorgesehen ist? Menschen sind fehl- und verführbar. Und je mehr Menschen immer mehr Daten sammeln und verwalten, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass diese in falsche Hände oder Kanäle geraten. Auch das macht mir Angst.
Das sind die fünf für mich wichtigsten Gründe, warum ich mich dafür einsetzen werde, dass die Recht- und Verhältnismäßigkeit solcher Datensammlungen (wieder)hergestellt wird. Es gibt noch ’zig andere Argumente, etwa der schleichende Druck zur Selbstzensur, wie ihn Pia Ziefle in ihrem Blog beschreibt. Bestimmt kennt jeder, der sich dieser Tage deshalb unwohl fühlt, noch eine Menge andere. Und selbst wenn nicht: denkt nach, informiert Euch – und entscheidet, ob und was Ihr dagegen tun könnt und wollt, wie zum Beispiel im Rahmen der Beteiligungsmöglichkeiten auf der Website der Digitalen Gesellschaft.
Ironischerweise beißt sich hier das Internet selbst in den Schwanz – wenn es dabei mithilft, die Überwachung einzudämmen, zu der es selbst die Verlockung und die Möglichkeiten bietet.
Ich bin trotzdem froh, dass es das Netz gibt.
Update: Kurz nach Veröffentlichung dieses Blogartikels erreichte mich der Link zu einem YouTube-Video des Comiczeichners manniac, das kurzweilig illustriert ebenfalls sehr viele der von mir resümierten Gedanken zusammenfasst. Anschauen und teilen empfohlen!

Image composing: formschub
Photo: © donsutherland1 | Some rights reserved