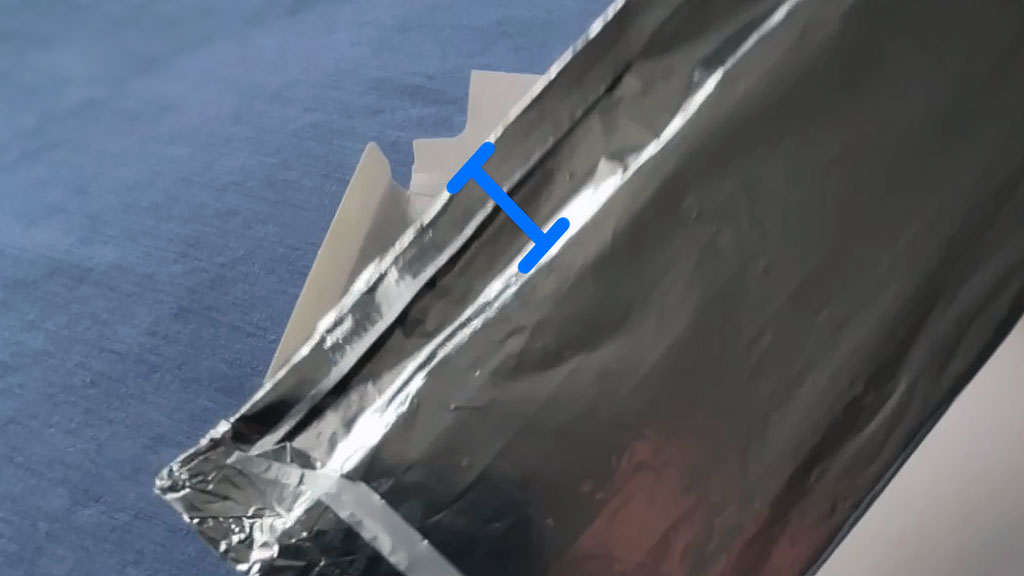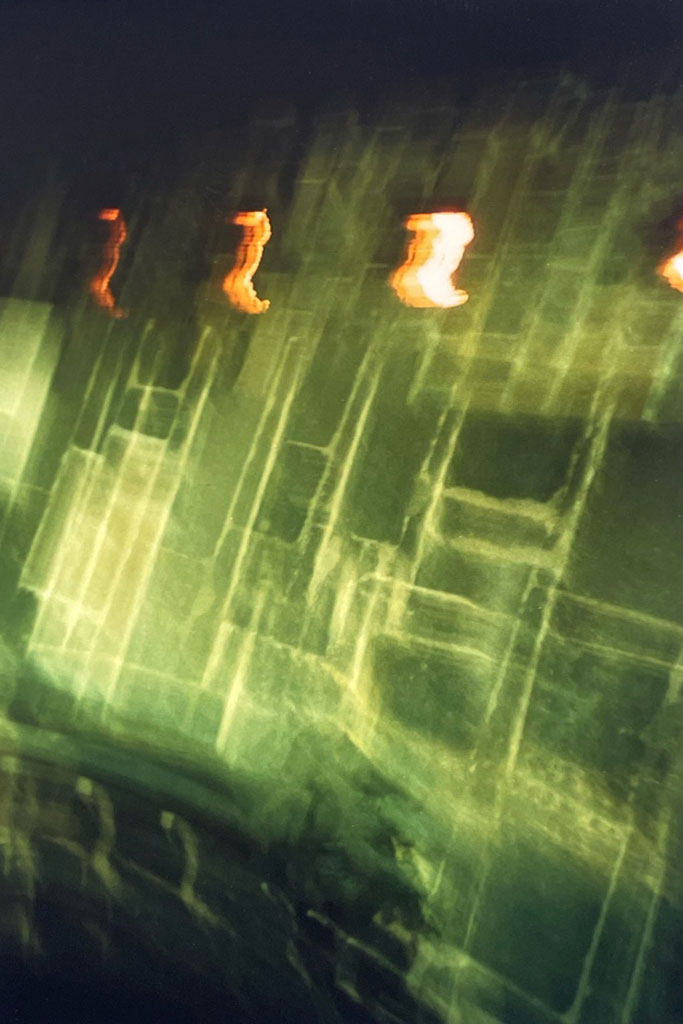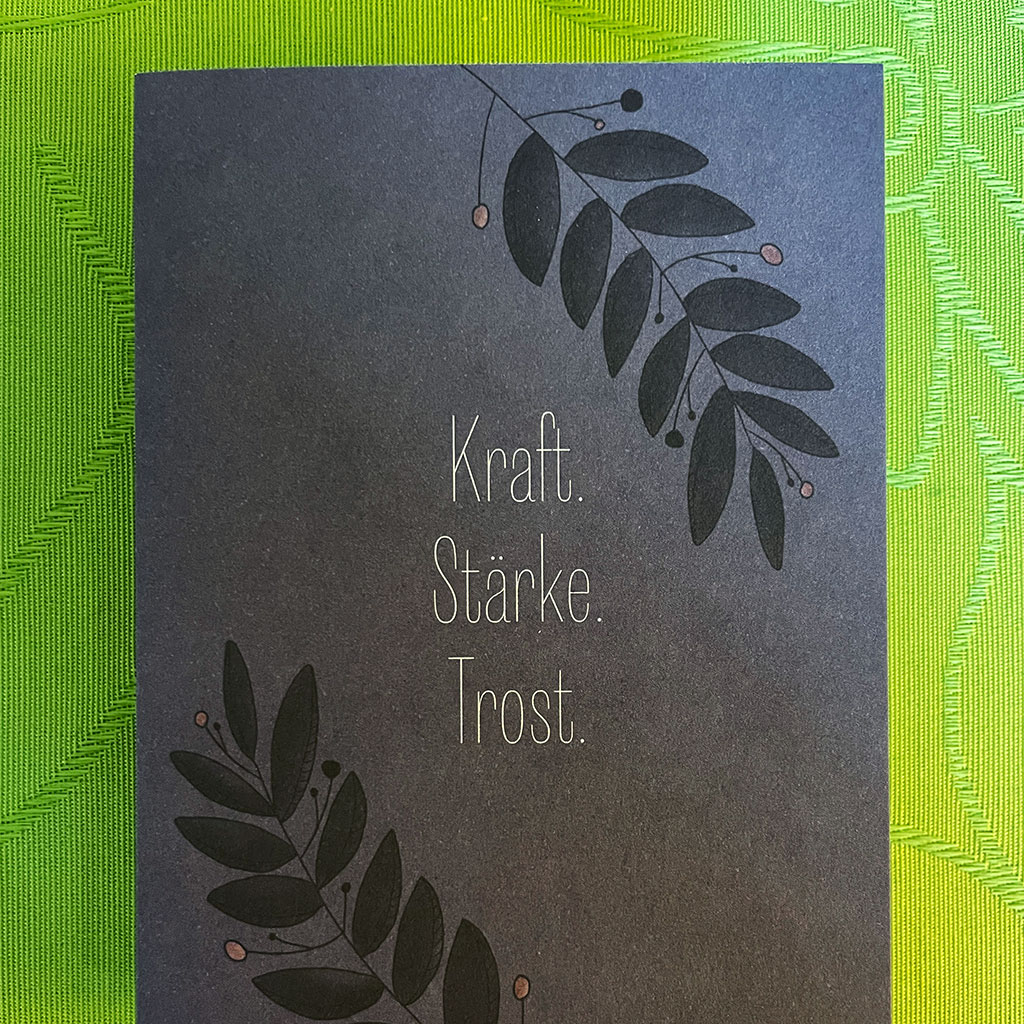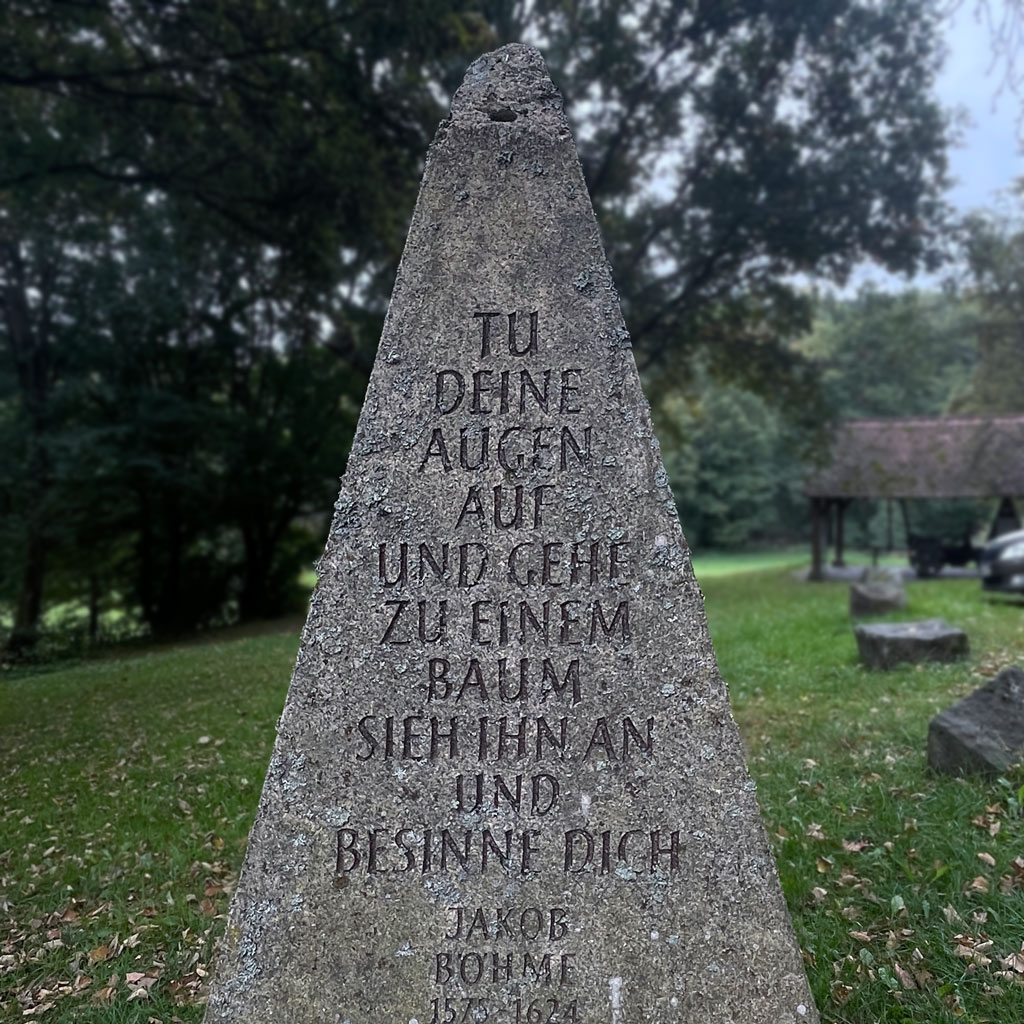Vor etwa 2–3 Wochen bemerkte ich an meiner linken Schulter in der Nähe der Achselhöhle einen rotvioletten Fleck. »Oh, ein Bluterguss«, dachte ich beiläufig, denn ich bin diesbezüglich extrem empfindlich. Ein leichter Stüber an einer Schrankkante oder eine etwas schwerere Reisetasche mit Trageriemen geschultert und schon erblüht an der Kontaktstelle ein vielfarbiges Hämatom. Nach einigen Tagen ändert sich dann die Farbpalette von Bordeaux und Purpur über Violett- und Blautöne hin zu Olivgrün und Braun und dann verblassen die Stoßmale allmählich. Nicht so diesmal. Das runde Gebilde hielt sich hartnäckig und schien sich zudem ganz langsam gelichmäßig auszudehnen. Das machte mich misstrauisch und ich suchte im Netz auf seriösen Medizinseiten nach Indizien dafür, was das wohl sein könnte. Die plausibelste Erklärung mit begleitendem, meinem Phänomen frappierend ähnlichem Bildmaterial, war eine sogenannte »Wanderröte« nach einem Insektenstich oder -biss (z.B. Mücke oder Zecke), die auf eine beginnende Infektion mit Borrelien hindeutet. Gegen FSME habe ich mich vorsorglich impfen lassen, da ich fast an jedem Wochenende in der Natur herumwandere, aber bei Borrelien ist das leider nicht möglich. In meinem entfernten Bekanntenkreis gibt es eine Person mit Frühverrentung aufgrund einer zu spät erkannten, eskalierten Borreliose, daher weiß ich: damit ist nicht zu spaßen. Also galt es, mir hier im Moselland, wo ich derzeit mit dem Mann auf Reisen bin, spontan einen Arzt zu suchen und zu hoffen, ohne Termin zur Begutachtung vorgelassen zu werden. Freitag. Das Wochenende stand vor der Tür. Ich fuhr in die nächstgrößere Stadt und suchte die erste der zuvor recherchierten Praxen auf. Fehlanzeige. Wartezimmer voll, das Empfangspersonal und die Ärzte spürbar über Kapazität. Aber man verwies mich dennoch sehr freundlich an die Praxis im selben Gebäude eine Etage höher. Dort am Empfang wurde ich tatsächlich sofort vorgelassen, die MFA erwartete nämlich in Kürze die letzte Abholung von Blutproben durch den Laborkurier und gewährte mir Vortritt, damit eine eventuell zu entnehmende Probe noch eine Chance hätte, im Labor anzukommen. Die Gesundheitskarte wurde eingelesen und ich durfte gleich durchgehen. Sehr nett.
Der behandelnde Arzt, der mich sodann in sein Sprechzimmer bat, ein betagtes, vermutlich kurz vor dem Ruhestand stehendes Urgestein, fragte nach meinen Beschwerden und stimmte dann nach Ansicht der Hautverfärbung meiner eigenen Vermutung zu. Sowohl an mich gewandt als auch mit einem Finger Daten zur Behandlung in seinen PC eintippend, murmelte er unentwegt vor sich hin: »Dasjan Bild wie aus dem Lehrbuch, keine Frage, schreibichihn’ was auf, Andibjodikum, Blutprobe brauchmanich, isja sonnklar. Amoxicillin oder Doxycyclin, nehmse zehn Tage lang, nee, besser zwei Wochen. Morngsunahms ne halbe, nehmwer die Zweihunderter, die könnse teilen. Wieviel sind’n da in der Packung? Ah, zwanzich, das reicht auf jeden Fall, danach sollten die Biester weg sein …«. Er erhob sich und geleitete mich zurück zum Empfangstresen, wo ich erwartete, ein papierenes Rezept ausgehändigt zu bekommen, zumal Arzt, MFA und ich direkt neben dem Drucker standen. Doch auf einmal sah mich die Assistentin an und sagte »Wir sind dann fertig.« – »Und mein Rezept?« – »Das ist schon auf Ihrer Karte. Elektronisch.«
Wow. Mein erstes E-Rezept. Und das in einer Praxis, in deren Ambiente, Arzt und Einrichtung sich sogar ein Nadeldrucker noch absolut stimmig eingefügt hätte. Ich war beeindruckt. Alle Achtung, Herr Lauterbach. Ich behielt die Karte gleich in der Hand, denn im Erdgeschoss des Ärztehauses hatte ich beim Hineingehen bereits eine Apotheke bemerkt. Vielleicht war das verordnete Medikament ja dort vorrätig und ich könnte mein digitales Rezept dort gleich einlösen.
Die Apothekerin nahm nach Hinweis auf das e-Rezept die Karte entgegen und las sie in ihr Terminal ein. Dann drückte sie auf einige Tasten und seufzte. »Das schon wieder!«, stöhnte sie. »Was denn?« fragte ich »Haben Sie das Mittel nicht da?« – »Doch, schon. Ich sehe es hier im System, haben wir vorrätig, aber ich kriege Ihr Rezept nicht von der Karte in die Kasse, so kann ich es nicht einbuchen. Aber ich probiere noch mal was anderes. Es gibt da verschiedene Wege, wie das gehen kann.« Sie tippte auf der Tastatur herum. Eine andere Apothekerin, die nebenstehend die Komplikation mitbekommen hatte, mischte sich ein. »Willer wieder nich?«, fragte sie. Die andere nickte. »Wenn du den Eintrag auf der Karte sehen kannst, dann druck den doch aus. Da ist dann ein QR-Code drauf und den kannst du den einscannen. So klappt das dann bei mir meistens.« – »Ich guck’ mal«, sagte die andere und tippte weiter. Sie nahm die Karte aus dem Schlitz heraus und führte sie erneut ein »Das ist SO umständlich!«. Ich teilte ihre Ernüchterung. »Da wären wir mit einem Papierrezept schon weiter«, sagte ich. »Allemal.«, antwortete sie, »Aber ich versuche es jetzt noch mal hiermit …«. *tipp, tipp* »Ah, jetzt geht’s!« Die Kasse piepte und spuckte einen Beleg aus. Sie übergab mir die Tablettenschachtel, die im Hintergrund aus einem Lagerschacht gefallen war und ich zahlte. Elektronisch. Irgendwie hatte ich mir das Einlösen meines ersten e-Rezepts moderner vorgestellt. Beiläufiger. Eleganter. Reibungsloser. Wieso gibt es hierzulande so viele digitale Prozesse, die entweder zwingend eine Etappe mit einem Papierausdruck benötigen oder einen mühseligen Workaround, den die entnervten Nutzer aus Verzweiflung selbst ausgeknobelt haben oder einen Neustart zur elektronischen Zurechtweisung des genutzten Systems? Oder eine Kombination davon?
»Gute Besserung!« sagte die Apothekerin zum Abschied.
»Danke!« sagte ich.
Mein aufrichtiges »Ihnen auch!« murmelte ich erst, als ich schon draußen war.
Symbolvideo: Man kann zwar oft erahnen, wie ein digitaler Prozess aussehen könnte, wenn er gekonnt implementiert worden wäre, aber angesichts der tatsächlichen Nutzererfahrung ist das nicht immer leicht.