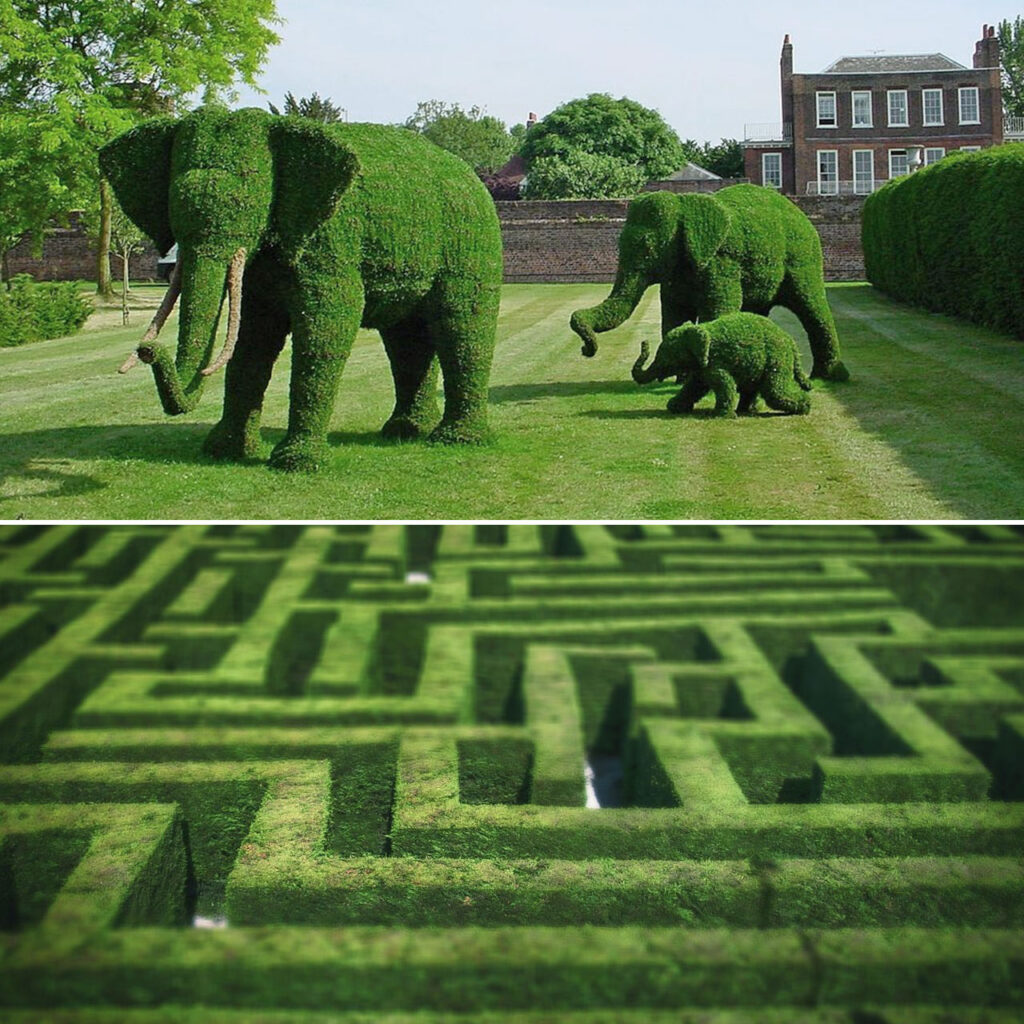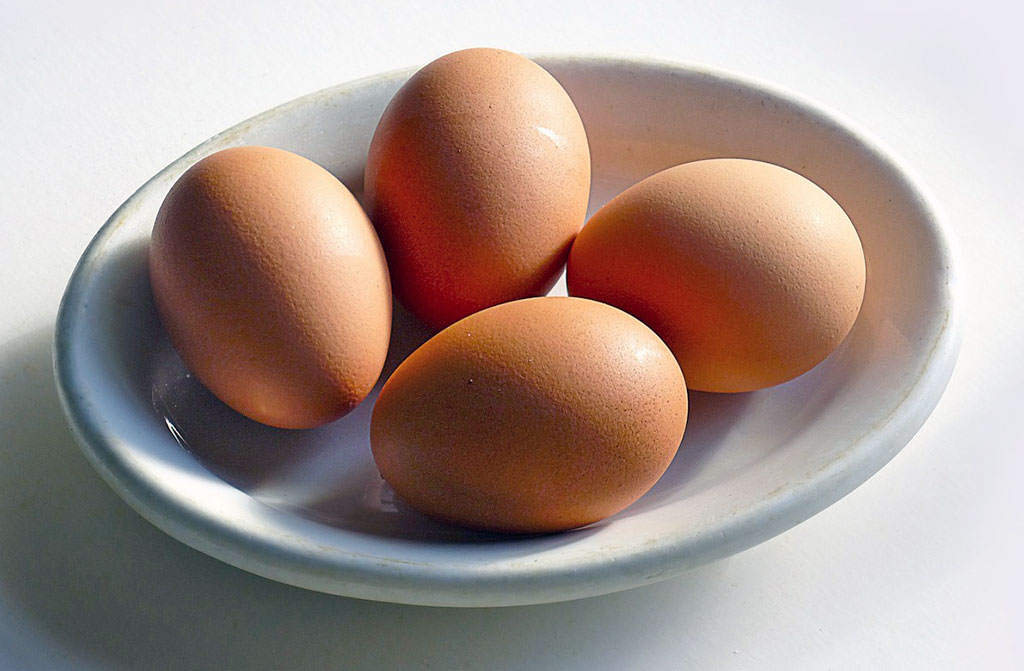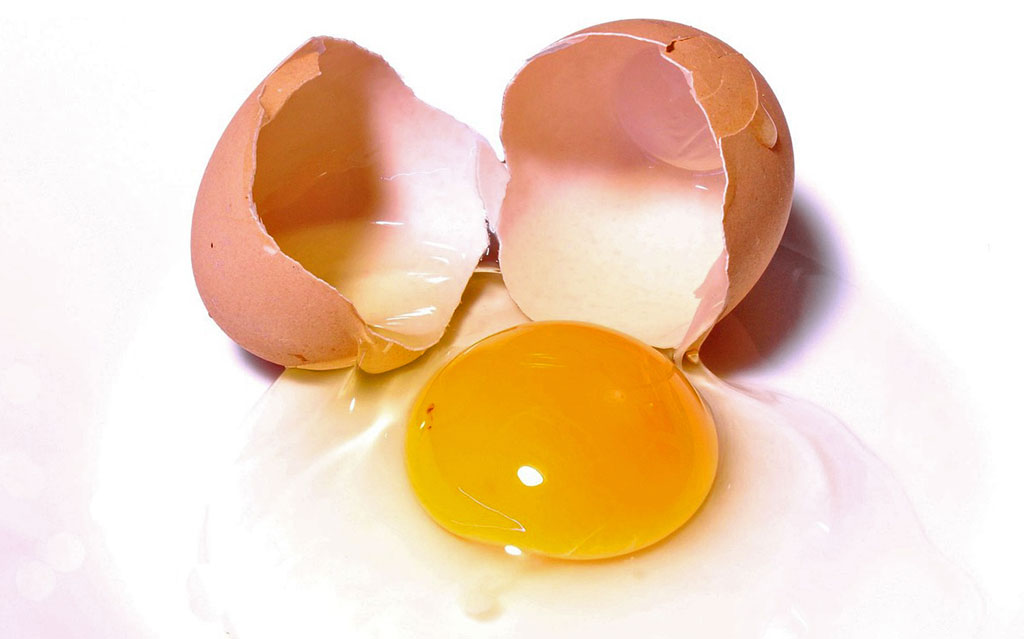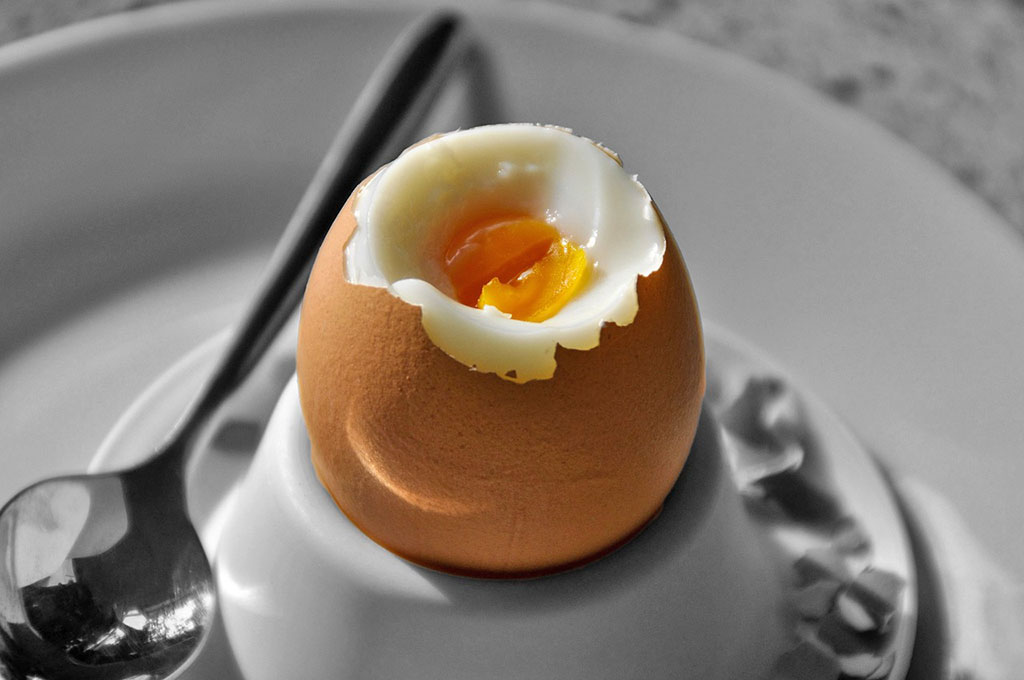Im vorletzten Blogartikel hatte ich ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben, wie praktisch es sein kann, Gewohnheiten zu folgen. Was man immer wieder oder regelmäßig macht, ist mental irgendwann so fest verdrahtet, dass es automatisch abläuft und man nicht mehr großartig darüber nachdenken muss. Wenn ich mich in ein Auto setze, schnalle ich mich automatisch an, ehe ich den Zündschlüssel rumdrehe. Inzwischen nahezu ein Reflex. Und seit ich mich einmal vor Ewigkeiten aus meiner Wohnung ausgesperrt habe, habe ich mir angewöhnt, den Fuß von außen in die Tür zu stellen, wenn ich die Wohnung verlasse, und zu prüfen, ob ich den Schlüssel dabeihabe, ehe ich den Fuß wegnehme, die Tür zuziehe und abschließe. Auch das ist bei mir erfolgreich zum Automatismus geworden.
Immer, wenn ein neues Jahr vor der Tür steht, drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob man für sich »gute Vorsätze« formulieren will. Das kann in der alltäglichen Praxis eigentlich nur dann klappen, wenn daraus baldmöglichst eine dauerhafte Gewohnheit entsteht. Für 2023 hatte ich mir nur zwei Vorsätze genommen: bei der Ernährung öfter auf Fleisch verzichten und in einem gesunden Maß sowie mit geruhsamem Tempo mein Gewicht zu reduzieren. Hat beides das komplette Jahr über ganz gut geklappt und wird mit dem Ziel einer weiter zu verfestigenden Gewohnheit ins Jahr 2024 mit rübergenommen.
Es gibt aber auch Gewohnheiten, bei denen es von Nachteil ist, dass man nicht mehr drüber nachdenkt. Nämlich wenn es sich um Routinen handelt, an die man sich gewöhnt hat, ohne sie noch bewusst zu hinterfragen. Die beste Analogie, die mir dazu einfällt, ist eine weiche, gepolstere Sitzkuhle auf dem heimischen Sofa an der Stelle, wo man am häufigsten Tag für Tag Platz nimmt. Sie zeigt mir schon vor dem Hinsetzen an, wo »mein Platz« ist; wenn ich dort sitze, ist es superbequem, aber durch die Vertiefung im Polster wird es auch zunehmend schwieriger, auch nur ein wenig die Position zu verändern. Ich müsste schon bewusst aufstehen und mich einen Platz weiter auf ein weniger eingesessenes Stück Sofa setzen, um aus dieser Gewohnheit wirklich rauszukommen. So merkte ich etwa im Laufe des letzten Jahres, dass sich das private »Einigeln«, das seit dem Beginn der Corona-Pandemie notgedrungen im Alltag Einzug hielt, bei mir immer noch anhält und sich zudem etwas mehr zu verfestigen droht, als es mir gefällt oder guttut. Durch 80–90% Homeoffice beschränkt sich die Kommunikation im Job mit den (wenigen) Kollegen und mit Kunden inzwischen hauptsächlich auf Videocalls. Ich merke aber, dass ich die persönliche Begegnung, Live-Teamwork, spontane Interaktionen oder auch einfach mal »zwischendurch Quatsch machen« vermisse. Schon im letzten Quartal 2023 habe ich daher begonnen, öfter mal wieder Live-Arbeitstreffen zu initiieren und möchte das auf jeden Fall fortsetzen. Auch im privaten Bereich habe ich bemerkt, dass der im persönlichen Kontakt gepflegte Freundeskreis etwas zu sehr geschrumpft ist, als mir das gefällt. Man ist zwar lose in Kontakt über Facebook, WhatsApp usw., aber das früher häufigere »mal was trinken gehen« oder »zusammen kochen/essen« z.B. ist deutlich reduziert. Kommt also auch mit auf den Plan »vom guten Vorsatz zur festen Gewohnheit«.
Verbunden mit der Wiederbelebung der Bande zu guten Freunden ist die Fortsetzung des Bestrebens, Menschen bewusst von mir fernzuhalten, die mir nicht gut tun. Auch hier steht die Gewohnheit im Weg, insbesondere online, denn allein, weil man jemandem im Internet schon eine gefühlte Ewigkeit folgt, darf das eigentlich kein Grund sein, missmutig gewordene Follower oder solche, deren Ansichten in die Befremdlichkeit abdriften, zu entfolgen. Hinfort mit allen, die schlechte Stimmung machen, das eigene Befinden trüben oder zu überflüsigem Stress führen. Dabei hilft auch das fortschreitende Alter – ich habe schlich keine Lust mehr, meine verbleibende Zeit unnötig mit Menschen, Kontakten und Interaktionen zu verplempern, bei denen ich es meiner Kontrolle unterliegt, sie zu beenden. Und das gilt auch für Menschen im realen Umfeld. Weg mit den Verdrussquellen, hinfort, hinfort!
Was mich auch noch ärgert, ist meine seit Jahren (zu) enge Bindung an Online-Lektüre. Das Internet hält mich massiv vom Bücherlesen ab – und damit bin ich bestimmt nicht alleine. Ich bin zwar mit vielen netten Followern verbunden, bin aktuell und umfassend informiert, aber die ständige Häppchenkost aus Postings, Blogbeiträgen, E-Mails, Nachrichtenmeldungen, Messages und Suchergebnissen schadet spürbar meiner Aufmerksamkeitsspanne – ich lese also nicht nur seltener längere Texte oder Bücher, sondern es fällt mir auch noch schwerer, wenn ich es tue, mich darauf zu konzentrieren und das ist nicht gut. Ob und wie ich es hinbekomme oder in eine Gewohnheit überführen kann, mich von Display und Monitor täglich oder mehrmals in der Woche zu lösen, weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es ja Tipps aus eigener Erfahrung der Leser? Ich würde mich freuen, davon zu hören.
In den letzten Wochen des Jahres musste ich an zwei Ereignisse aus meinem eigenen Umfeld denken, die symbolisch ebenfalls schädliche, aber leider recht verbreitete Gewohnheiten aufzeigen. Die erste Anekdote ist mir ausgesprochen peinlich, aber da das fragliche Ereignis inzwischen gut 35 Jahre her ist und mich zudem nachhaltig geläutert hat, habe ich mittlerweile etwas Distanz dazu. Es muss in den Jahren 1987–1989 geschehen sein, ich war damals Anfang 20, als meine »Stamm-Discothek« in meinem Wohnort zur Silvesterparty einlud. Das Angebot, mit einer begrenzten Anzahl von Tickets, bot zu einem Eintrittspreis von 50,– DM den ganzen Abend freie Versorgung mit Speisen und Getränken – ohne Limits. Mit zwei Freunden griff ich zu, erwarb ein Ticket und so begann am SIlversterabend gegen 21 Uhr unsere Jahreswechsel-Sause im besagten Club. Um Essen zu bekommen, musste man zwar an den Tresen gehen, aber die Getränke waren in großen Kühltruhen für jeden Gast frei zugänglich: Bier, Wein, Sekt, Wodka, Tonic, Cola, Gin, Bitter Lemon, Whisky – all inklusive. Und es wurde ein verhängnisvoller Jugendexzess. Ich habe den Jahreswechsel um zwölf vor Ort nicht mehr in einem hinreichend klaren Zustand erlebt. Schon weit vor Mitternacht hatte das ungehemmt wahrgenommene Angebot an durcheinander getrunkenen (ich sage bewusst nicht »genossenen«) Spirituosen aller Art zu starker Übelkeit mit entsprechender oraler Ausstoßreaktion geführt und so verließ ich die Party zwar ohne Filmriss, aber sehr betrunken, derangiert, befleckt und indisponiert und fuhr noch im alten Jahr mit einem Taxi nach Hause. Wie grauenvoll der Kater am nächsten Morgen war, erinnere ich zwar nicht mehr, aber ein solch unmäßiges Erlebnis mit Alkohol wiederholte sich bei mir nie wieder.
Das andere Vorkommnis wurde mir von meiner Mutter berichtet, die in den 1990er Jahren eine Zeitlang in ihrer damaligen Wohnung in der Nähe von Hannover ein Gästezimmer an Besucher oder Standpersonal der Hannover Messe vermietete. Ein englischsprachiger Gast zog für die Dauer der Veranstaltung bei ihr ein, benahm sich dem ersten Eindruck nach gesittet und unauffällig, wenngleich er oft erst spät abends in die Unterkunft zurückkehrte, und reiste am Ende der Messewoche frühmorgens unter Hinterlassung des Zimmerschlüssels wieder ab. Bei der nachfolgenden Raumpflege und Reinigung erwartete meine Mutter dann, unter dem sorgfältig über das Bett drapierten Federbett, eine ergiebige Lache Erbrochenes. Auch dieser Gast hatte wohl am Vorabend über die Stränge geschlagen und sich ohne Hinweis auf seinen Fauxpas aus dem Staub gemacht, was ihn jedoch nicht davor verschonen sollte, sich nachfolgend schriftlich mit meiner zu Recht erbosten Mutter auseinandersetzen und zumindest materiell für Schadenersatz sorgen zu müssen.
Wo ist der Bezug zu den davor geäußerten Gedanken? Das Bild der zum Pauschalpreis offenstehenden Party-Kühltruhe und der mit einem eigentlich lächerlichen Preis abgegoltene »all inclusive«-Zugriff auf die nahezu unerschöpfliche Vorräte drin, ohne Gedanken an diejenigen, die dieses Angebot bereitstellen, an die Folgen des unmäßigen Konsums, oder an jene, die mit den Hinterlassenschaften konfrontiert werden bzw. sie zu beseitigen haben, hat für mein Empfinden einiges gemein mit unserer »westlichen« Lebensweise, die von vielen Leuten immer noch mit dem Wort »Wohlstand« bezeichnet wird, obwohl Überkonsum eigentlich treffender wäre. Und wenn, wie in der zweiten Geschichte, die Folgen dreckig, peinlich, eigentlich unübersehbar und womöglich unumkehrbar sind, diese mit einer blütenweißen (metaphorischen) Decke zu kaschieren, ist das m.E. ein recht passendes Bild dafür, wie viele (gewerbliche) Verursacher sich verhalten und damit leider oft nach wie vor in der Öffentlichkeit »durchkommen«.
Ein Begleitgedanke, der mir kürzlich noch kam, als ich negative Kommentare im Netz auf fremde (und bisweilen auch eigene) Beiträge las, dockt ebenfalls lose an der Silvesteranekdote an. Kann es sein, dass viele Menschen das monatliche oder prepaid entrichtete Entgelt für ihren Internetzugang irrtümlich ebefalls als eine Art »Pauschalpreis« interpretieren, der sie glauben macht, damit auch einen festen Anspruch auf Art, Inhalt und Formulierung der (kostenlosen) Inhalte zu haben, die sie dort konsumieren? Eine Art »VIP-Logen-Attitüde«, die sie vermeintlich befugt, trotz Freikarte an allem rumzunölen und gleichzeitig Anpassung und Änderung einzufordern, wo eigentlich nur eine unverfängliche private Meinung oder Alltagsnotiz gepostet wird, die ihnen missfällt? Ich sehe ein, dass jemand, der (ungeprüft) ein Buch kauft, eine Zeitschrift, Zeitung, eine Kinokarte, eine Filmdatei oder ein anderes kommerziell erzeugtes Produkt, das Bedürfnis hat, den erworbenen und bezahlten Content – auch öffentlich – bei Mängeln oder Missfallen zu kritisieren. Bildqualität schlecht, Schauspieler miserabel, Handlung unlogisch, Regie, Schnitt, Übersetzung, Lektorat mangelhaft, schmeckt nicht, billig verarbeitet – alles legitime Kritikpunkte, sofern ich für mein Geld einen direkten Gegenwert erhalten habe. Aber wenn jemand einen Monatsbeitrag an seinen Internetprovider bezahlt, zu fordern, dass private User auf den von ihm/ihr konsumierten kostenfreien Kanälen oder Social-Media-Plattformen ihren Content auf seine/ihre Bedürfnisse oder Weltsicht abstimmen, erscheint mir das nicht nur anmaßend, sondern absurd. Ja, natürlich gilt uneingeschränkt die Meinungsfreiheit und jeder kann mir, wenn es ihn oder sie partout drängt, mir oder anderen gegenteilige und beliebig schnoddrige Kommentare unter deren Online-Beiträge packen. Ich verstehe nur nicht, warum es so vielen ein Bedürfnis ist, dies bei lediglich geschmacks- oder interessenbedingt abweichenden Ansichten zu tun und dafür zudem eine beträchtliche Menge Zeit zu investieren. Jeder (kostenfrei zugängliche) Supermarkt hat zahllose Produkte im Sortiment, die mich nicht interessieren, für die ich keinen Bedarf habe, die ich nicht mag oder sogar verabscheue. Ich gehe dort einkaufen, wähle aus, was mir gefällt oder was ich benötige, zahle dafür und habe auch stets das Recht auf Reklamation bei Produktmängeln, oft sogar bei nachträglichem Nichtgefallen. Aber gehe ich durch die Gänge und klebe Post-Its mit Mäkel- und Aversionsparolen an die Regale mit Babywindeln, Harzer Käse, Rollmops, Duftkerzen oder Monatshygieneartikeln? Oder verlange ich zeternd vom Marktleiter, dass die mir persönlich nicht genehmen Produkte unverzüglich aus dem Sortiment des Marktes genommen werden sollen? Wohl kaum. Im Netz ist dieses Denkmuster jedoch auffallend häufig anzutreffen. Wieso nicht öfter gönnen können, Differenzen aushalten, über unbedeutende Fehler hinwegsehen, sich entweder mitfreuen oder weiterscrollen, akzeptieren, dass die Welt bunt ist und die Vorlieben, Geschmäcker und Interessen vielfältig sind, zur Kenntnis nehmen, dass nicht jeder Content für den eigenen Bedarf erstellt wird und kapieren, dass es bei privaten Postings keinen Anspruch darauf gibt, dergleichen einzufordern.
Gerne kann auch das von mir aus eine Gewohnheit werden, die im neuen Jahr mehr Freunde findet.