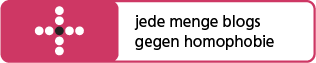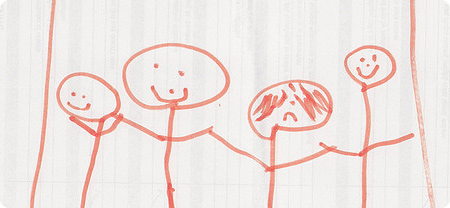Laut einer Studie der GfK gehöre ich zur Minderheit der Deutschen, die pro Monat gerne mehr als dreimal »auswärts« essen gehen. Davon profitieren zwar oft – bevorzugt in Hamburg oder Berlin – Restaurants meines Vertrauens, doch ebenso gerne probiere ich Empfehlungen von Freunden, aus Gastro- und Stadtmagazinen, aus dem Web oder spontane Entdeckungen am Wegesrand aus. Von zweien dieser Erlebnisse handelt der heutige Blogbeitrag.
Das Besondere daran war für mich die Diskrepanz zwischen Ambition und Performance bzw. zwischen Küche und Service. Eigentlich ist es das höchste Lob, nach einem Restaurantbesuch einfach sagen zu können »das war gut« – und zwar alles: Service, Angebot, Preisgestaltung, Essen, Getränke, Atmosphäre. Jede Einschränkung wie »bis auf« oder »außer« trübt das Prädikat. Es gibt aber immer wieder Gastronomen, die auf ihrer Website oder dem Vorblatt der Speisekarte wohlklingende Ansprüche formulieren und sie dann nur teilweise einlösen – in der Hoffnung, dass gute Küche oder edle Innenarchitektur andere Versäumnisse ausgleichen. Doch das gelingt nur selten – und wenn, dann mit bitterem Nachgeschmack.
Die erste gastronomische Begegnung führte mich ungeplant ins Restaurant Louisiana Kid (Update: inzwischen geschlossen) in der Nähe des Hackeschen Markts in Berlin. Es war der Vorabend einer Urlaubsreise und wir wollten zu zweit ohne großen Aufwand in der heimischen Küche ein schönes Dinner genießen. Ungeplant war die Einkehr deshalb, weil unter der angesteuerten Adresse am Stadtbahnbogen nicht mehr, wie erwartet, der Italiener La Rustica residierte, sondern das besagte Südstaatenlokal. Und da im Außenbereich genug Plätze frei waren, beschlossen wir, zu bleiben.
Das freundliche Bedienpersonal brachte die Karte. »Das Louisiana Kid bemüht sich stets, eine möglichst authentische Küche auf den Tisch zu bringen. Alle unsere Gerichte werden frisch zubereitet, in Zeiten des großen Andrangs müssen unsere Gäste daher mit ein wenig Wartezeit rechnen«, hieß es da. Doch da das Lokal nur mäßig besucht war, vernachlässigten wir diesen Hinweis.
Nach der Bestellung folgte ein Abstecher auf die sanitären Anlagen. Dazu war, ebenso wie für die ständig ein und aus laufenden Servicekräfte, der trendy mit Sand ausgestreute Außenbereich zu verlassen und der mit hochglänzenden Steinfliesen ausgelegte Innenbereich zu durchqueren. Hip, aber unpraktisch, denn trotz der großen Fußmatte vor der Eingangstür zog sich innen eine breite, unansehnliche Sandspur ambientemindernd quer durch den Gastraum. Die Toilette (Herren) war tadellos sauber, doch der Seifenspender hing frei an der Wand seitlich neben dem Becken, eine feuchtglänzende Seifenlache auf dem Boden darunter. Statt eines Handtrockners hatte man sich für Papierhandtücher entschieden. Völlig okay, doch das Volumen des dafür vorgesehenen Minimülleimers wäre spätestens nach dem vierten Besucher erschöpft. All das wertet ein Lokal zwar nicht unmittelbar ab, aber wirft dennoch die Frage auf, warum so an der Praxis vorbeigedacht wurde.
Zurück am Platz wurden die bestellten Vorsuppen serviert. Obwohl nicht zum Mitessen gedacht, irritierte mich zuerst der mit Balsamicosirup dekorierte Tellerrand. Als authentisch karibisch empfand ich diese inzwischen allgegenwärtige Dekolangeweile ebensowenig wie die in der Suppe schwimmenden Rosmarincroutons. Geschmacklich war die Suppe – eine tomatige Fischsuppe mit Shrimpseinlage – akzeptabel, allerdings deutlich weniger originell als die englischen Texte in der Speisekarte. In weltgewandter Vorbereitung auf Touristen hatte man dort das in einer Speise enthaltene Krebsfleisch als »Crap Meat« übersetzt. Doch offenbar waren keine Engländer anwesend, denn wir hörten niemanden lachen.
Das Warten auf die Hauptspeise schließlich zementierte die Urteilsfindung. Trotz mindestens halbleerer Tische und ungeachtet einer Zwischenmeldung, eines der beiden Gerichte würde »etwas länger dauern« kam der Hauptgang für meine Begleitung erst auf den Tisch, als ich bereits die letzten Soßenreste vom Teller kratzte.
Egal, aus welchem Anlass und in welcher Konstellation zwei Personen einen gemeinsamen Restaurantabend verbringen: ein solcher Servicelapsus ist indiskutabel. Was im Gedächtnis blieb, waren der freundliche Service, eine herbe Enttäuschung – und etwas Sand unter den Schuhen.
Ortswechsel. In Hamburg gibt es seit einigen Jahren regelmäßig die schöne Initiative des Schlemmersommers. Fast 90 Restaurants servieren im Rahmen des Angebots – 2009 vom 15. Juni bis 15. August – ein mehrgängiges Sommermenü für zwei Personen zum Festpreis von 59 Euro (ohne Getränke). Eine gute Gelegenheit, ausgetretene Genusspfade zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren. Unsere Wahl fiel auf das Fillet of Soul auf dem Freigelände hinter den Hamburger Deichtorhallen. Auf dem Speiseplan stand:
- Rucola-Basilikum-Salat mit Wassermelone, Spargel, Hüttenkäse und Thunfisch im Szechuanpfeffer
- Poulardenbrust im Serranomantel mit Safranrisotto, Pinienkernen und Paprika-Oliven-Salsa
- Karamellisierter Key-Lime Pie mit Minzerdbeeren und Joghurteis
Angenehm fern vom bewegten Verkehr dieser Gegend bietet das Lokal einen geräumigen, verglasten Gastraum und einen großzügigen Bereich mit Außensitzplätzen, auf dem wir an dem betreffenden Sommerabend zu viert einen Tisch einnahmen. Obwohl wir beim Eintreffen in das etwa halbvolle Etablissement von einer Servicekraft begrüßt und platziert wurden, vergingen gut zehn Minuten, bis ein Satz Karten an unserem Tisch eintraf. Ebenso geruhsam waren die Intervalle bis zur Aufnahme der Getränkebestellung, deren vollständiger, in mehrere Etappen zerdehnter Auslieferung und der Entgegennahme der Speisewünsche. Doch dann sollten wir erfahren, was Warten wirklich bedeutet.
Etwa eine halbe Stunde dauerte es, bis die Vorspeisen ihren Weg zu uns fanden. Erschwert wurde die Wartezeit zusätzlich dadurch, dass das ziemlich unaufmerksame und m.E. eher nach der äußeren Erscheinung gecastete Serviceteam selbst den Getränkenachschub zur Herausforderung machte. Die Umgangsformen des Personals würde ich noch wohlwollend als »flapsig« bezeichnen, dass es nach einer ersten Kritik an der langen Wartezeit dann zwar einen Getränkegang aufs Haus gab, allerdings nur für zwei von uns Vieren, werte ich als Fauxpas.
Schließlich kam das Essen – und es war phantastisch. Tolle Aromen, fantasievolle Rezepturen, feine Zutaten, originell angerichtet, hervorragend gewürzt. Die gewagte, leichte Kombination der Vorspeisenzutaten inspirierte zu ähnlichen Experimenten in der heimischen Küche, der Kontrast der Konsistenzen im Hauptgericht war wunderbar ausgewogen und die angenehm frischen, nicht zu süßen Komponenten des Desserts bildeten einen perfekten Ausklang. Die nicht zu großen Portionen erlaubten es, ohne schlechtes Gewissen jeden Teller zu leeren und trotz der lauen Abendtemperaturen nicht gleich ins Phlegma zu sinken. Ein großes Lob an die Küchenkünstler, die jedoch ihr offensichtliches Credo »Feines braucht Zeit« (ehemaliger Slogan einer Keksfirma) für mein Empfinden an diesem Abend etwas überstrapazierten. Wir sind auf jeden Fall bereit, dem Fillet of Soul noch eine Chance zu geben. Mit besserem Timing und lernwilligem Personal wäre es eine echte Adresse.
Was ist nun mein Fazit nach diesen beiden Gastroabenteuern? In beiden Fällen hatte ich das Gefühl, dass Wirte, Köche und Kellner sich und ihren Job viel stärker mit den Augen ihrer Gäste hätten sehen sollen. Vielleicht sollten auch sie gelegentlich in einem Restaurant mal richtig gut essen gehen.

Fotos (metaphorische Fotomontage):
Dessert © ukcountryhousehotelsandspas | some rights reserved
Dead fly © Samyra Serin | some rights reserved