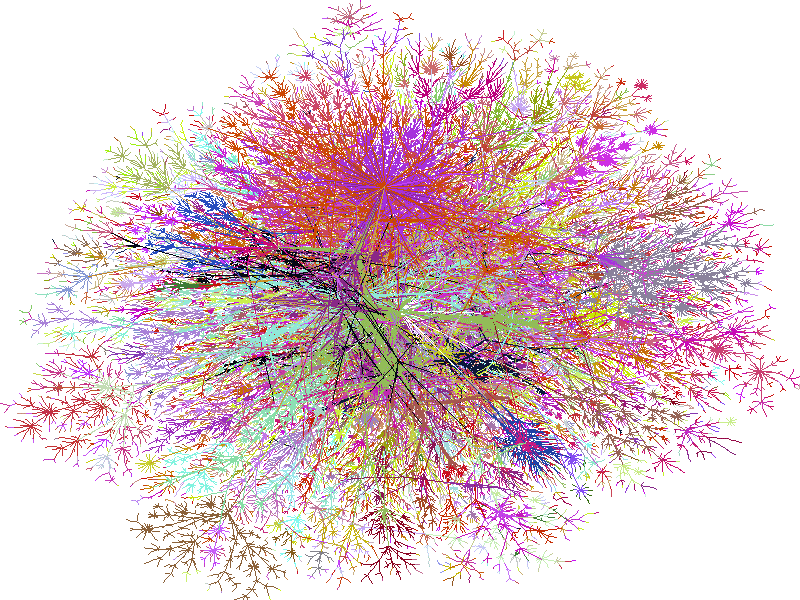Ich war nie sonderlich religiös. Zwar wurde ich evangelisch getauft und auch meine Eltern gehörten dieser Kirchengemeinschaft an, aber der Glaube wurde in unserer Familie nie großartig praktiziert. Ich erinnere mich kaum an Kirchgänge während meiner Kindheit und Jugend, nicht einmal zu Weihnachten. Ganz hinten unten in meiner Erinnerung finde ich Echos an das Aufsagen von Kindernachgebeten (»Ich bin klein, mein Herz ist rein …«), aber das war zu früh, um es mit reflektiertem Glauben zu verbinden.
Mit 16 – zwei Jahre nach dem frühen Tod meines Vaters – nahm ich am Konfirmandenunterricht teil. Mitgenommen aus dieser Zeit habe ich nur die Erinnerung an langweilige Nachmittage in einem Schulklassenraum und an einen dunklen Pastor mit noch dunklerem Bartschatten, dessen Erzählungen zu biblischen Geschichten mich nur mäßig gefesselt oder beeindruckt, geschweige denn an so etwas wie Glauben herangeführt haben. Ich wüsste nicht einmal auswendig, welcher Konfirmationsspruch mir mitgegeben wurde. Gut hingegen erinnere ich mich an die erste eigene Stereoanlage (Tangentialplattenspieler FTW!), die ich mir von meinem Konfirmationsgeld anschaffen konnte und an ein heiteres Missgeschick an der nachmittäglichen Kaffetatfel, in das eine Bekannte meiner Mutter, ihr schwarzer Angorapullover und ein Sahnesiphon involviert waren. Vielleicht hat auch mein Schicksal als Halbwaise ein wenig damit zu tun, dass mich ein Gott, der meinen Vater sterben ließ, auch im Teenageralter nie wirklich für sich gewinnen konnte.
In der Schule lehrte mich dann der Geschichtsunterricht, dass es Kreuzzüge und Religionskriege gab. Ich begriff, dass die Kirche, ebenso wie die Bibel, manche Verhaltensweisen und Menschen als »Sünde« und »Sünder« klassifizierten, dass es Geistliche und einen Gott zu geben schien, die über das Sein und Wirken der Menschen richteten, um sie dafür zu schelten oder zu bestrafen. Auch die Institution Kirche ging mir zunehmend auf die Nerven mit ihren Riten, ihrem in realitätsfernen Dogmen erstarrten Konservativismus und ihrer für mich anmaßenden Einmischung in das Leben und Privatleben der Menschen. Das gefiel mir immer weniger, so dass ich – nicht zuletzt aufgrund meiner schwulen Selbstfindung – Mitte der Neunziger aus der Kirche austrat. Seither bezeichne ich mich als »Agnostiker«.
Vor kurzem unterhielt ich mich mit einem – gläubigen – Freund über das Thema Gott und Kirche und ich versuchte, zu beschreiben, wie ich Gott sähe, wenn ich von seiner Existenz ausginge. Ich hatte das nie zuvor versucht, gezielt in Worte zu fassen, war aber mit der Beschreibung ziemlich zufrieden. Selbst mein (evangelischer) Gesprächspartner fand meine Sichtweise überraschenderweise plausibel.
Ich bin fasziniert von dem, was man als »Schöpfung« bezeichnen könnte. Vom Universum, dem Werden und Vergehen der Sterne, den unfassbaren Dimensionen des Weltalls, den kosmischen Zusammenhängen und dem filigranen Ineinandergreifen der Naturgesetze. Ich bewundere die Formen-, Arten- und Lebensvielfalt der Natur, die bizarren Gebirge und Canyons, Wolken, Wellen, Kristalle und Dünen in der unbelebten Natur ebenso wie Pflanzen, Pilze, Tiere und Mikroben in der belebten. Die realen Formen gigantischer Spiralnebel und die mathematisch erzeugten Unendlichkeiten filigraner Fraktale lassen mich staunen und den Atem anhalten. Das Leben ist etwas Unglaubliches, allein die Vielfalt und die Abhängigkeiten innerhalb der Biosphäre der Erde übersteigen jedes Fassungsvermögen. Ich müsste lügen, wenn mich nicht auch die Frage beschäftigen würde, wie all das entstanden ist und woraus. Aber gleichzeitig ist das alles in seiner Gesamtheit auch so atemberaubend, dass es mir lächerlich erscheint, wenn der Mensch inmitten all dessen eine Sonderstellung für sich beansprucht.
Der Gott, an den ich glauben könnte, ist ein wohlwollender, aber nicht intervenierender, rein schöpferischer Nerd, der etwas von übergreifender Schönheit erschaffen wollte. Wie ein Künstler, der ein unendlich großes Dominosteinfeld austüftelte, das nach dem Anstoß des ersten Steins auf unabsehbare Zeit immer neue Wege einschlüge, während er/sie/es daneben säße und den Ablauf der Dinge aufmerksam verfolgte.
Zu dieser Schönheit gehören auch Verfall, Tod, Verwesung, Leid und Zerstörung, jedes Lebewesen z.B. trägt Atome verglühter, explodierter Sterne in sich, jede Fäulnis ist der Nährboden neuen Lebens. Diesen Gott anzurufen, um Schutz und Gerechtigkeit zu beanspruchen, ist müßig, denn alles, was geschieht, ist Bestandteil des Ganzen. Beten, gemeinsam oder allein, Kirchenlieder singen und prachtvolle Kirchen bauen, mag uns helfen, trösten, beeindrucken oder erfreuen, aber dieser Gott bliebe davon unbeeindruckt. Von diesem Gott zu verlangen, über Menschen oder Verhaltensweisen zu richten oder sie zu bestrafen, wäre anmaßend, denn ein Kieselstein, eine Alge, ein Baum oder ein Insekt sind ihm genauso wichtig oder gleichgültig inmitten des Ganzen wie ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen und das, was sie tun.
Dieser Gott freut sich über jedes Lebewesen, das sein Dasein genießt, ohne nach einem tieferen Sinn dafür zu fragen. Er ist nicht zuständig für Frieden, Beistand, Trost und Hilfe, das müssen die Menschen selber zu leisten lernen, doch es ist mühsamer als das Anrufen höherer Mächte und Instanzen, vielleicht funktioniert es deshalb nach wie vor nicht sonderlich gut. Ich verabscheue die Bezeichnung »Krone der Schöpfung« für die Menschheit, denn es wäre erstens eine sehr blutige und dunkle Krone und zweitens wird die Schöpfung nie eine tragen, denn sie geht immer weiter, vielleicht endlos, vielleicht irgendwann in einem neuen Urknall kollabierend, wer weiß das schon.
Damit kann ich leben.

Photo: © ChaoticMind75 on flickr | Some rights reserved