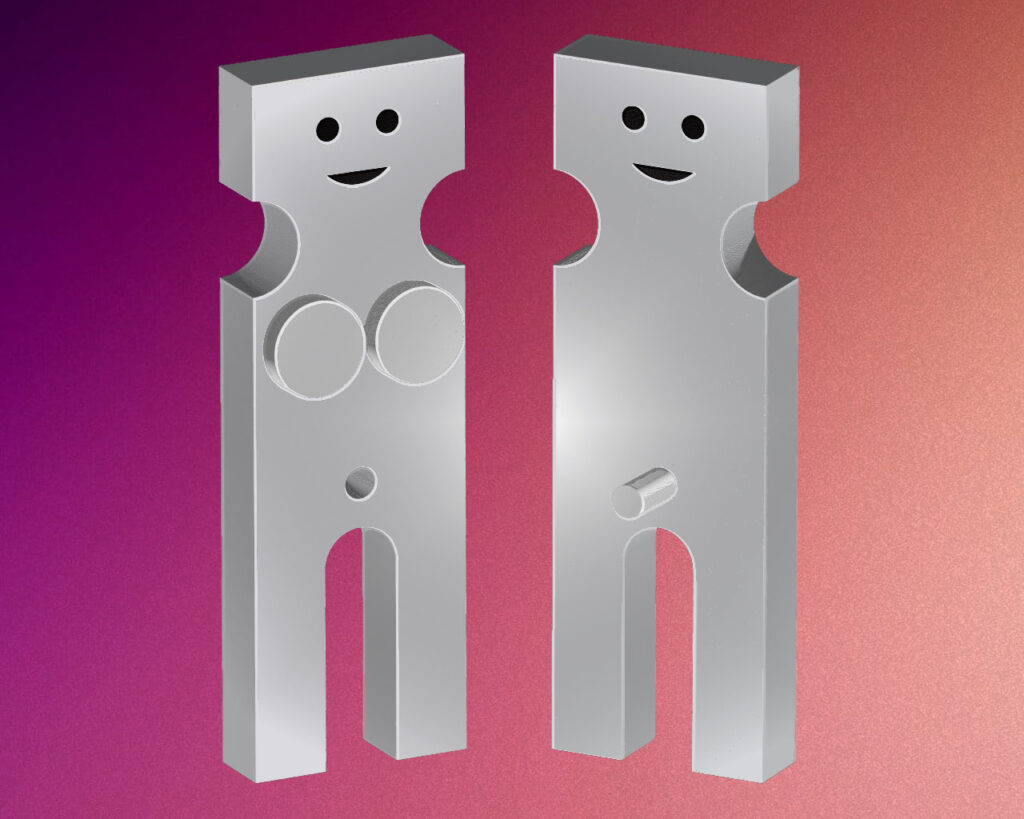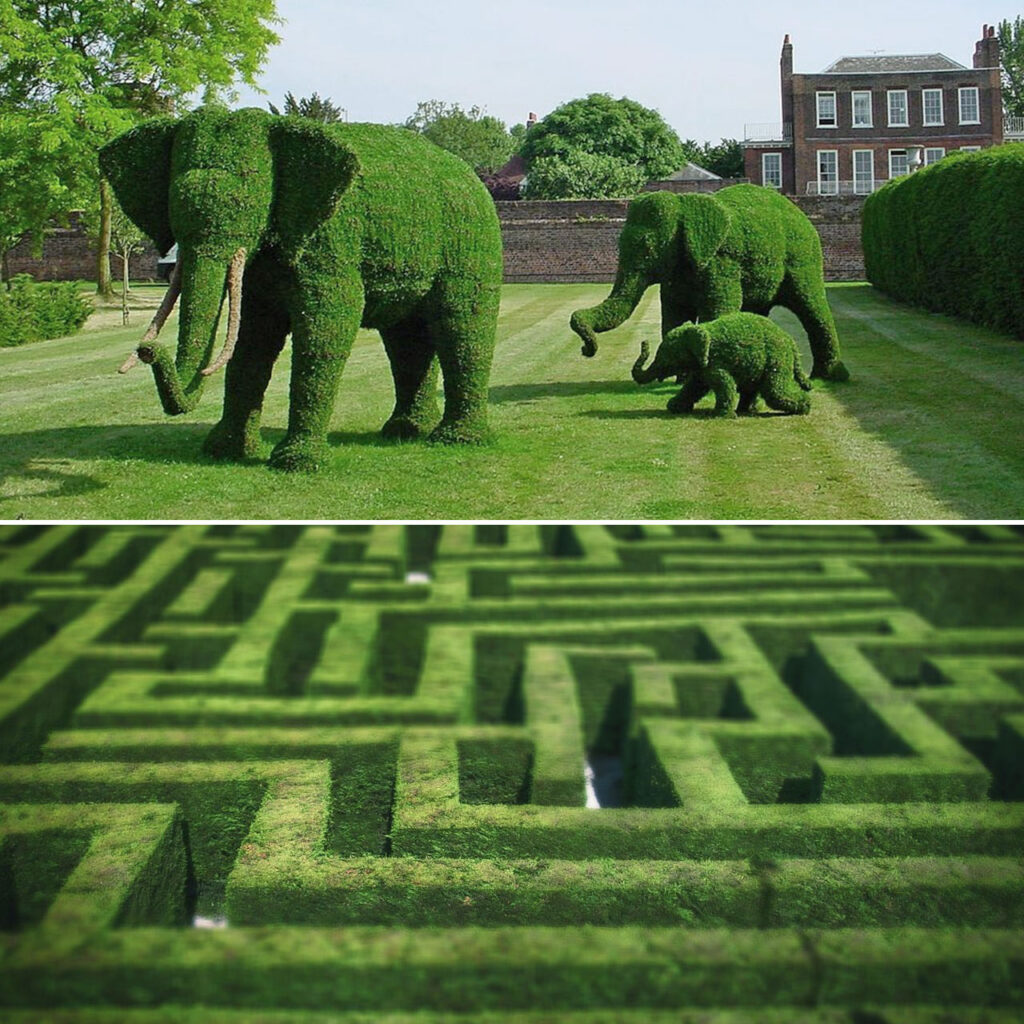Seit einigen Jahren hat sich in der jährlichen Reiseplanung des hiesigen »Haushalts« eine schöne Gepflogenheit herausgebildet: Schon seit 2016 zog es uns bisweilen Anfang/Mitte Juni nach Stralsund, um einzelnen Konzerten der »Greifswalder Bachwoche« beizuwohnen (Mit übrigens wirklich interessanten Ideen abseits des klassischen Mainstreams, in diesem Jahr z.B. ein Konzert mit Synthesizer und Theremin in einer Dorfkirche [S. 29 im PDF des Programmhefts] und eine Aufführung mit Breakdance zu Bachs »Wohltemperiertem Klavier« [S. 55 im PDF des Programmhefts]! Beides passte aber leider nicht mehr in die diesjährige Unternehmungsplanung.). Nachdem der Mann und ich im Juni 2019 dann hier in der Nähe auf einem Aussichtsturm standesamtlich geheiratet haben, kommen wir nach Möglichkeit jedes Jahr her, um neben dem Musikgenuss diesen Jahrestag zu feiern – und Geburtstag hat der Mann einen Tag zuvor auch noch.
Dieses Jahr war es wieder soweit. Eine Woche Stralsund bei schönem, wenn auch für die Natur deutlich zu trockenen Wetter und viel Zeit für Wanderungen, Ausflüge und Schlemmereien in der Umgebung der Hansestadt und auf Rügen.
Am Samstag reisten wir an und holten abends noch die vorher reservierten Fahrräder ab. Das Rad ist zu dieser Jahreszeit und angesichts vieler sehr gut ausgebauter Radrouten in der Gegend die absolut beste Art, sich fortzubewegen. Am Abend machten wir dann nur einen kleinen Ausflug an den Hafen, um dort – nach einem Bier-Aperitif im Braugasthaus »Dolden Mädel« – im italienischen Restaurant »Bellini« das Abendessen zu genießen. Ich freute mich, als ich eine Vorspeise, die ich noch aus dem letzten Jahr kannte, immer noch auf der Karte wiederfand: eine Cremige kühle Burrata mit einem warmen Cherrytomaten-Vanille-Ragout. Das hatte mir 2022 so gut geschmeckt, dass ich schon letztes Jahr das Gericht in »Kitchen Impossible«-Manier versucht habe, daheim nachzukochen. Sehr gelungen, wie ich finde, das Rezept steht auch hier im Blog.

Am Sonntag nach dem späten Frühstück holten wir unsere damalige Trauzeugin vom Bahnhof in Stralsund ab, sie ist Musikerin und sollte am Montag das Eröffnungskonzert der Bachwoche spielen. Nachmittags, während sie noch einmal fleißig übte, machten wir zu zweit eine kleine lokale Wanderung (mit einigen Sackgassen, die im Widerspruch zum Wegenetz der zuvor geplanten Komoot-Wanderroute standen) und probierten am Abend gemeinsam das im Netz zwar gut bewertete, aber im Vergleich mit bisher erlebten Highlights eher durchschnittliche orientalische Lokal »Shammaas Küche« aus. Schmeckte alles gut, aber reichte nicht an z.B. Shady (Leipzig), Qadmous (Berlin) oder Fardi (Hamburg) heran.
Am Montag musste ich vormittags einige Stunden im »Ostsee-Homeoffice« arbeiten, während sich am frühen Nachmittag Künstlerin und Mann schon zum Konzertort aufmachten. Ich fuhr, nach einigen Besorgungen in der Stralsunder Innenstadt, mit dem Zug hinterher (»Praise the Lord for the 49-Euro-Ticket!«) um ebenfalls das zarte, schöne Konzert zu genießen. Nach dem Konzert und der Rückfahrt in die Unterkunft, eine hübsche private Ferienwohnung nahe am Wasser des Sunds, ließen wir uns dann abends zu dritt Bier und Dinner im »Dolden Mädel« schmecken.
Am Dienstag mussten wir uns schon wieder von der Musikerfreundin verabschieden (Termine, Termine …). Für den Nachmittag war dann tatsächlich mal wieder eine etwas längere Wanderung (Komoot-Link) angesetzt: Vom Parkplatz der Rügener Insel-Brauerei (nicht ohne Hintergedanke der Ausgangspunkt der Tour) wanderten wir im Bogen über den kleinen Ort Grabitz bis an die Küste zum Kubitzer Bodden und im Bogen wieder zurück zur Brauerei, wo uns eine hopfige Erfrischung belohnte. Aus Geburtstagsgründen war die Einkehr zum Abendessen heute deutlich feiner: im Restaurant »Zum Scheele« des Stralsunder Hotels Scheelehof genossen wir köstliche »Sterneküche ohne Sterne«, denn der Koch des Lokals hat dem Stress der Verteidigung seiner früheren Sterne entsagt und kocht nun einfach genausogut und ohne diese Auszeichnung weiter. So schmeckt Work-Life-Balance!


Am Mittwoch wollten wir dann mal die Räder so richtig ausnutzen und so plante der Mann eine Tour, die wir im Sattel sitzend zurücklegen konnten. Es begann am Stralsunder Fährhafen, von wo wir mit den Rädern nach Altefähr auf Rügen übersetzten und dann ab dort einer schönen 28 km langen Rundroute folgten (Komoot-Link). Nach einer Zwischenstation bei der Insel-Brauerei (schon wieder!), wo im benachbarten Hofladen frischer Räucherfisch fürs Abendessen – das heute mal in der Unterkunft serviert werden sollte – besorgt wurde, radelten wir weiter, vervollständigten die Verpflegung mit Möhren und Ingwer für eine asiatisch aromatisierte Gemüsebeilage und machten es uns den Rest des Abends dann »inhouse« gemütlich. (Seit der Ankunft hier war eine abendliche Folge »Picard« täglicher Teil des Abendprogramms; die dritte Staffel hat m.E. gegenüber den ersten beiden deutlich an Spannung und Tempo zugelegt und bietet erhebliches Binge-Potenzial.)
Update: Ich hatte ganz vergessen, dass wir es am Mittwoch morgen wagten, am nahegelegenen Sund-Badestrand das »Anbaden 2023« zu vollziehen. Das Wasser war frisch, nicht zu kalt und wenn man erst einmal drin und abgekühlt war, fühlte es sich sehr angenehm an. Das Gefälle ins Meer hinein ist an diesem Stand sehr moderat, so dass man noch gut 100 m vom Strand entfernt gerade mal hüfthoch im Wasser steht. Als ich mit Schwimmbewegungen begann, spürte ich zwischen den Fingern plötzlich kleine götterspeisige Klümpchen hindurchgleiten und als ich mich aufrichtete und von oben ins Wasser sah, bemerkte ich Hunderte kleiner, etwa walnussgroßer Quallen mit dünnem violettem Ornament auf der Oberseite, die im Wasser umherschwammen. Da sie aber offensichtlich nicht nesselten, denn bei einer Berührung war nichts zu spüren, schwamm ich einfach weiter umher. Interessanterweise waren sie dann am Donnerstag und Freitag wieder komplett aus dieser Badezone verschwunden.

Der heute etwas kürzere Ausflug am Donnerstag Nachmittag führte zur Südspitze der Insel Rügen, dem »Palmer Ort« in der Nähe des Ortes Zudar. Auf sandigem Grund und durch von Kiefern dominierte Wälder ging der Hinweg, am kiesigen Strand der fast brandungslosen Küste entlang, lag dann der Rückweg (Komoot-Link). Während der Wanderung kam, nach einer eher bewölkten ersten Tageshälfte, die Sonne noch einmal überraschend zum Vorschein, so dass wir streckenweise möglichst im Schatten der Bäume zu bleiben versuchten. Sonnenwärme macht bekanntlich durstig, und so musste natürlich die Insel-Brauerei nochmals als Erfrischungsort herhalten. Nach der Rückfahrt stiegen wir um aufs Rad und fuhren zum Hafenlokal »Fischermänns«, wo die Wahl zum Abendessen auf eine Portion »Fish & Chips« und eine sehr schmackhafte Currywurst fiel. Schon auf dem Hinweg zum Restaurant spürte ich einige vereinzelte Regentropfen auf meiner Haut und tatsächlich sah man auf dem Regenradar – endlich einmal! – ein mäßig großes Regengebiet heranziehen. Die Rückfahrt vom Lokal zur Unterkunft verlief noch annähernd trocken bei ganz leichtem Tröpfeln, aber später »zu Hause« war deutlich das Klopfen des Regens auf den Fensterscheiben zu hören. Die Natur brauchte es dringend, von mir aus hätte es die Nacht durchregnen können.

Am Freitag war während der Wandertour ein eingebettetes Bad im Meer nach etwa 2/3 der Strecke vorgesehen. Während der Stralsund-Tour vor einem Jahr hatten wir in der Nähe des Ortes Lauterbach mitten im Wald am Meeresufer einen wunderschönen kleinen, feinsandigen, versteckten Badestrand entdeckt. Bei dem schönen Wetter heute schrie das förmlich nach einer Wiederholung. Also wurden Badehosen und Handtücher in den Rucksack gepackt und los ging’s. Der Weg durch den Wald war fast noch schöner als im letzten Jahr, man merkte, dass die letzten Monate mit mehr Niederschlag als 2022 gesegnet waren, Bäume und Vegetation am Waldboden waren üppiger und grüner. Doch als wir an dem Strändchen ankamen, war die Enttäuschung groß: Das Wasser und der Strand waren voll mit glitschigen braunen Algen, der komplette Gegensatz zum klaren sauberen Zustand von vor einem Jahr. Dort, wo sich die Algen in dicker Schicht an Land türmten, waren sie bereits in Fäulnis übergegangen und stanken, im Wasser waberten sie auf einem ca. 75 m breiten Streifen im Wasser, man konnte dazwischen kaum auf den Grund sehen. Sehr schade! Die Badepause musste somit entfallen und wir setzten unseren Rundweg weiter bis zum Ausgangspunkt fort.

Nach dem obligatorischen »Bierstopp« an der Inselbrauerei fuhren wir zurück zur Unterkunft, wechselten zur Badehose, stiegen aufs Rad und holten das Bad im Meer einfach an der algen- und quallenlosen Badestelle quasi vor der Haustür nach. Dann kurz zurück, geduscht, stadtfein gemacht und zum »Abschiedsessen« an den Bootshafen geradelt. Ziel heute: das feine Restaurant »Lara« direkt gegenüber dem Ozeaneum. Die Speisekarte ist frisch und regional und wird so spontan nach Marktlage erstellt, dass sie nicht im Internet einsehbar ist. Enttäuscht wurden wir dort aber bislang noch nie – und so war es auch diesmal. Nach einem Körbchen mit hausgebackenem Brot und einigen kross frittierten Blumenkohlnuggets mit einem Klecks fein gewürzter Mayonnaise als Küchengruß genoss ich als Vorspeise gebratete Jakobsmuscheln auf Mandel-Knoblauch-Schaum mit marinierten Pfirsichstückchen und als Hauptgericht ein zart-rustikales gebratenes Kotelett vom Duroc-Schwein mit Chorizo-Kartoffelstampf und grünen Bohnen. Als der Kellner abräumte und fragte, ob es geschmeckt habe, antwortete ich »Duroc’n’Roll!« und man sah ihm an, wie sehr ihm dieses Lob gefiel.

Zurück in der Unterkunft musste dann vor der abendlichen »Hygge« noch die Abfahrt am Samstag vorbereitet werden: Aufräumen, zusammensuchen, sortieren, einpacken. Bei einem Glas Wein streamte dann vor dem Schlafengehen noch eine (die vorletzte!) Folge »Picard«, dann war der letzte Tag vorüber. Morgen früh um 10 Uhr folgt erstmal die Rückreise nach Berlin und am Montag für mich dann die Heimkehr nach Hamburg.
Mach’s gut, Stralsund, bis nächstes Jahr!